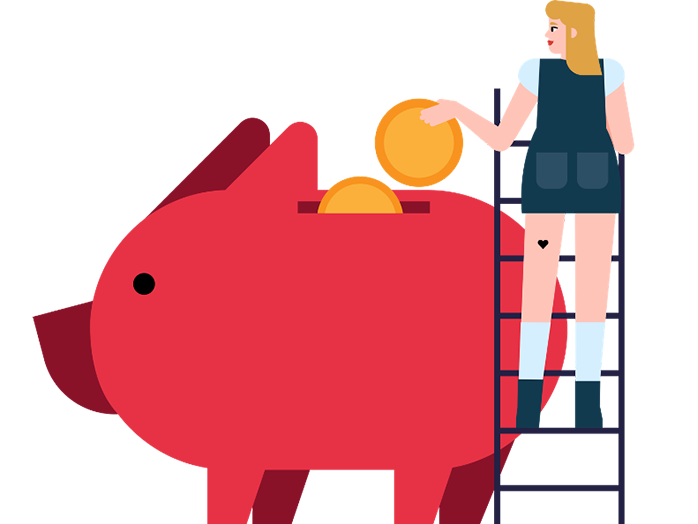Die Psychologie des Hausgeldeffekts
Mit geschenktem Geld riskiert man mehr

Stellen Sie sich vor: Sie gewinnen 10.000 Euro im Lotto. Würden Sie dieses Geld genauso umsichtig ausgeben wie Ihren hart erarbeiteten Lohn? Wahrscheinlich nicht. Dieses Phänomen beschreibt der sogenannte House-Money-Effekt oder Hausgeldeffekt – eine weit verbreitete psychologische Verzerrung, die unser Finanzverhalten maßgeblich beeinflusst.
Was steckt hinter dem Hausgeldeffekt?
Denn mit unverhofften Geldbeträgen gehen Menschen oft deutlich leichtsinniger und spendierfreudiger um als mit ihrem regulär erzielten Einkommen. Der Name stammt ursprünglich aus der Glücksspielwelt: Spielerinnen und Spieler bezeichnen Casinogewinne als „House Money“. Ein klassisches Phänomen ist es im Glücksspielbereich, dass mit dem durch Glück und Zufall „erbeuteten“ Geld riskanter umgegangen wird als mit dem ursprünglichen Einsatz. In der Forschung wird dieses sogenannte Windfall-Gains-Verhalten (Verhalten bei unerwarteten Gewinnen) als klassisches Beispiel für irrationale Entscheidungen betrachtet.
Die Psychologie des riskanten Geldverhaltens
Der Hausgeldeffekt wurzelt psychologisch betrachtet in unserem evolutionären Erbe. Unser Gehirn behandelt verschiedene Geldquellen wie separate Konten. Diese „mentale Buchführung“ zeigt, dass wir verschiedene Geldquellen unterschiedlich bewerten. Geschenke oder gewonnene Beträge werden oft als „Spielgeld“ wahrgenommen und emotional weniger stark mit harter Arbeit oder Verzicht verknüpft. „Mental Accounting beschreibt die Neigung von Menschen, finanzielle Transaktionen je nach Herkunft und Verwendung des Geldes auf gedanklich getrennten Konten zu verbuchen“, erläutert Senior Investment Analyst Maik Engelkamp vom Ausbildungsunternehmen DeltaValue. „Geld wird dabei nicht als einheitliche Ressource betrachtet, sondern unterschiedlich bewertet – je nachdem, aus welcher Quelle es stammt und welchem ‚mentalen Konto‘ es zugeordnet wird.“ Dies beeinflusse maßgeblich die Bereitschaft, Geld auszugeben oder Risiken einzugehen.
Die Verhaltensökonomen Shane Frederick, George Löwenstein and Ted O'Donoghue beschrieben das Phänomen mit dem Konzept des „present bias“, sprich zeitkonsistenten Präferenzen. Demnach bewirkt die zeitliche Nähe zu einer Belohnung einen stärkeren „Hungerinstinkt“, was den Impuls zur sofortigen Ausgabe des Geldgeschenks antreibt.
Eine im April 2025 veröffentlichte nichtrepräsentative Studie des Unternehmens Invest4Kids zeigt, wie junge Erwachsene mit plötzlichen Geldzugängen umgehen. Danach fehlt vielen Teilnehmenden eine durchdachte „mentale Buchführung" für unerwarteten Geldsegen. Selbst normalerweise sparsame junge Menschen würden bei größeren Summen oft unüberlegte Entscheidungen treffen. Es mangele grundsätzlich an klaren Zielen, Investitionswissen und Mechanismen gegen impulsive Ausgaben.
Alltägliche Beispiele des House-Money-Effekts
Der Hausgeldeffekt zeigt sich in vielen Lebensbereichen, vor allem aber am Finanzmarkt. Anlegerinnen und Anleger überschätzen ihre Fähigkeiten bei Finanzentscheidungen, wenn sie mit „Bonusgeld“ hantieren (sogenannter „Investor Bias”). Sie investieren in riskante Aktien oder treffen andere irrationale Entscheidungen, die sie mit ihrem regulären Einkommen niemals getroffen hätten. Selbst erfahrene Finanzexpertinnen und -experten sind nicht immun gegen dieses irrationale Verhalten. Und: Verbraucherinnen und Verbraucher geben Bonuszahlungen häufiger für Luxusgüter aus, während sie bei ihrem Grundgehalt sparsamer sind.
Risiken und langfristige Folgen
Das Problem beim House-Money-Effekt liegt in den langfristigen Konsequenzen. Wer regelmäßig Geld irrational ausgibt, verpasst Chancen zum Vermögensaufbau. Unerwartete Einnahmen könnten sinnvoll investiert oder zur Schuldentilgung verwendet werden, statt für spontane Ausgaben verschwendet zu werden. Kritisch wird es bei größeren Summen: Erbschaften, Abfindungen oder größere Gewinne werden oft nicht optimal genutzt. Studien zeigen, dass Menschen, die plötzlich zu Geld kommen, häufig innerhalb weniger Jahre wieder ihre ursprüngliche finanzielle Situation erreichen.
Strategien für den bewussten Umgang mit unverhofftem Geld
Die gute Nachricht ist: Sie können den House-Money-Effekt überwinden und kluge Entscheidungen treffen. Dazu sollten Sie sich ein Bewusstsein für diesen psychologischen Mechanismus erarbeiten:
Behandeln Sie jedes Geld gleich, unabhängig von seiner Herkunft.
Etablieren Sie eine 24-Stunden-Regel: Treffen Sie keine spontanen Entscheidungen über größere unerwartete Geldbeträge. Überlegen Sie stattdessen, wie dieses Geld Ihre langfristigen Ziele unterstützen kann.
Teilen Sie den Betrag auf: Ein Teil für spontane Freude, ein Teil für mittelfristige Wünsche und ein Teil für die Altersvorsorge.
Holen Sie sich professionelle Beratung, besonders bei größeren Summen. Finanzberaterinnen und -berater können Ihnen helfen, rationale Entscheidungen zu treffen und den emotionalen Aspekt des „geschenkten“ Geldes zu neutralisieren.
Der House-Money-Effekt mag ein natürlicher psychologischer Mechanismus sein, aber Sie sind ihm nicht hilflos ausgeliefert. Mit Bewusstsein, Strategie und der richtigen Einstellung können Sie jede unerwartete Geldsumme zu einem echten Gewinn für Ihre finanzielle Zukunft machen.